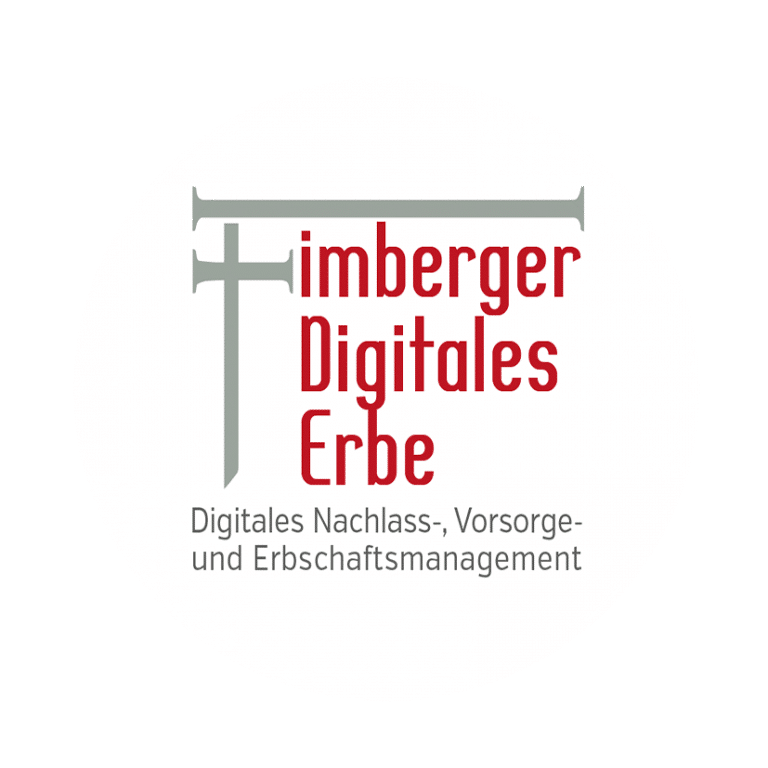Will man wirklich alles wissen?
Will man wirklich alles wissen?
Ein Artikel des Goethe Instituts: Quelle
Der Vater unserer Autorin ist verstorben. Er hinterließ nicht nur Bücher, Hemden und ein Haus, sondern auch einen Facebook-, Amazon und andere Accounts. Wie aber geht man mit dieser Erbschaft um, und wie beendet man ein digitales Dasein?
Meine Oma sammelt alles. In ihrer Küche kann man nicht sitzen, weil sich auf dem Sofa alte Zeitungsausschnitte, Taschentüchervorräte für das nächste Jahrhundert und die Papierhüllen von Teebeuteln stapeln. Die benutzt sie, um darauf wichtige Dinge zu notieren, wie zum Beispiel: „Pia fährt bald weg nach ???“ Und der Teebeutelzettel bleibt jahrelang auf dem Tisch liegen, weil ich ja immer wieder nach ??? fahre. Früher stand ich manchmal in dieser Küche, schüttelte mit dem Kopf und fragte mich: „Warum? Schmeiß doch einfach alles weg.“
Seit mein Vater gestorben ist, bin ich dankbar für diese reale, anfassbare Sammelleidenschaft meiner Oma. Mein Vater war ganz das Gegenteil. Je älter er wurde, desto weniger Dinge besaß er. Als wir nach seinem Tod seinen Besitz aufteilen wollten, blieb, abgesehen von dem Haus, in dem er lebte, wenig Persönliches übrig: seine alten Brillen, ein paar zerlesene Bücher, verwaschene Hemden.
Und dann waren da natürlich sein Facebook-Tagebuch, die Amazon-Bestellhistorie und eine Liste überbotener Ebay-Auktionen. Theoretisch zumindest, denn praktisch hatten wir nur einen schwarzen alten Laptop und drei Festplatten. Nicht nur das, wir hatten auch Versicherungsordner, die zur Jahrtausendwende endeten, Broschüren von eröffneten Bankkonten ohne jeglichen Kontoauszug, eine Liste mit kryptischen Zahlenkombinationen, von denen wir keine Ahnung hatten, was sie codierten.
Irgendwann hatte mein Vater angefangen, sein Leben nur noch digital zu organisieren. Würde man in seinen Laptop hineinkriechen können, es sehe darin vermutlich genauso aus wie in der Küche meiner Oma. Nur, dass man bei ihr eben schneller erkennt, was in den großen Schredder kann und was nicht. Und das ist ein Problem.
Immerhin, mein Vater hatte sein Passwort seit Jahren nicht geändert. Meine Geschwister haben keine Ahnung von Computern, also wurde ich da – vorgesetzt. Ich kam mir vor wie bei der großen Abiturprüfung in Ethik. Bei der Frage, warum Achilles die Schildkröte nie einholen könnte, wenn er ihr einen Vorsprung gewähren würde. Die Frage so einfach, das Ergebnis unmöglich. „Such mal den Stromanbieter, damit er uns nicht den Saft abstellt“, sagte meine Schwester. „Ich muss wissen, wie viele Bankkonten es eigentlich gab“, sagte meine Mutter. „Kannst du sehen, wo das Auto versichert ist?“, fragte mein Bruder.
Was macht man als Erstes? Google fragen natürlich. Der Google-Gott weiß alles. Aber als ich nur „www“ in das Browserfenster eingebe, bekomme ich eine Reihe von Seiten vorgeschlagen, von denen ich nicht wissen möchte, dass mein Vater sie besucht hat. Also zurück zum Anfang: Was macht man als Erstes? Den Browserverlauf löschen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre, auch Tote. Finde ich zumindest.

Goethe Institut Homepage
Ich fühle mich mies, als ob ich etwas Verbotenes tun würde
Will ich eigentlich wissen, was mein Vater so gemacht hat, wenn er nicht mein Vater war? Wenn er Mann war oder Online-Zocker oder Nerd? „Oft wissen Angehörige nicht, was alles Teil einer digitalen Identität sein kann“, sagt Christopher Eiler. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er Columba gegründet. Sie kümmern sich um den digitalen Nachlass, haben eine Software entwickelt, die das Netz nach Mitgliedschaften, Verträgen und Accounts durchkämmt, sie auflöst, überträgt oder in Gedenkzustände versetzt; als mein Vater starb, wusste ich noch nichts von Columba. Über 100.000 Fälle haben er und sein Team seit 2013 übernommen. Es ist die digitale Version dessen, was Bestatter seit jeher anbieten: Formalitäten erledigen.
„Im Durchschnitt hat ein Verstorbener zwölf Mitgliedschaften und Verträge“, sagt Eiler. Tendenz steigend, denn die Generation, die mit Facebook und Co. groß geworden ist, ist gerade erst in ihren 40er Jahren.
Mein Vater war ein sogenannter „Early Adopter“, ein Pionier, der auf jeden Trend aufgesprungen ist. Wir hatten sehr früh schon Commodore Rechner, BTX, Bildschirmtext, ein Vorläufer des Internets, aber ein Nachfahre des Videotextes. Und eines der ersten Mobiltelefone in der Größe eines Aktenkoffers. Auf seinem letzten Rechner finde ich Hinweise auf Facebook, Paypal, Ebay, Amazon. Sie alle schicken meinem Vater Mails, und ich lese sie. Sein Mailpostfach ist unverschlüsselt. Ich fühle mich dabei mies, als ob ich et – was Verbotenes tun würde. All das geht mich nichts an, finde ich, während ich beginne, das digitale Sterben meines Vaters einzuleiten, Wochen nach seinem Tod in der realen Welt. Ich schreibe an soziale Netzwerke, Online-Warenhäuser und Newsletter. Das mit den Newslettern lasse ich schnell wieder, zu aufwendig und zu banal. Wen interessiert es schon, ob es da eine Karteileiche im Verteiler gibt oder nicht? Irgendwann werde ich die Mailadresse meines Vaters löschen, und der Verteiler wird eine Fehlermeldung erhalten.
Ich habe diesen Menschen geliebt, und ich will nicht, dass sich das ändert.
Es ist nicht einfach, Accounts zu löschen, ein standardisiertes Prozedere fehlt. Einige Anbieter haben in der hintersten Ecke ihrer FAQs einen Hinweis auf Sterbefälle, bei anderen hänge ich stundenlang in telefonischen Hotlines, wieder andere haben einen dämlichen Chat mit automatisierten Bots, die alles nur noch schlimmer machen. Mit einer Maschine, einem Nicht-Menschen über einen Toten schreiben? Grotesk und doch erst der Anfang. Es folgt ein düsteres Labyrinth der Bürokratie. Nach einer Weile komme ich mir vor wie eine Verwaltungsangestellte, die nur noch abhakt, was von wem benötigt wird: Sterbeurkunde, Personalausweise, Erbscheine, Bestätigungen aller Erben, dass ich berechtigt bin zu tun, was ich gedenke zu tun. Jeder Dienstleister möchte eine andere Kombination der Dokumente. Jede Woche einen Account regeln, nehme ich mir vor, zu mehr fehlt es mir an Kraft und Geduld.
Ich wünschte, mein Vater hätte bei Facebook einen Nachlasskontakt angegeben, was man mittlerweile kann. Oder bei Google einen Freund angegeben, der als nächster Angehöriger benachrichtigt wird, im Falle des Falles. Kontoinaktivitätsmanager nennt man es dort. Oder er hätte einen digitalen Sekretär benutzt, wie ihn einige Webseiten anbieten, wo er all seine Mitgliedschaften hinterlegt hat. Oder von mir aus auch eine umfangreiche analoge Zettelwirtschaft erstellt wie meine Oma, auf alten Teebeutelverpackungen Listen mit Accounts und Passwörtern. Aber wer, bitte, denkt schon zu Lebzeiten, wenn er gesund und agil ist, darüber nach, wie alles geregelt werden soll, wenn er mal nicht mehr ist? Ich habe es selbst mittlerweile versucht und musste feststellen, dass ich einen Tag brauche, um all meine digitalen Identitätsteile aufzulisten. Vermutlich habe ich sogar welche vergessen, immerhin hatte ich lange vor Facebook schon Myspace- Seiten. Da sammelt sich einiges an.
„Mitgliedschaften, von denen man weiß, sind kein Problem“, sagt Eiler. Wer seinen Dienst bucht, gibt an, welche Accounts der Verstorbene hatte, und Eiler erledigt den Rest. Stunden, ach was, Tage des Ärgerns und Fluchens hätte ich mir somit ersparen können. Und noch mehr. Denn Eilers Software fragt auch bei Hunderten von Portalen und Dienstleistern an auf der Suche nach Mitgliedschaften, von denen niemand weiß. Auf seiner Webseite kann jeder Kunde nach dem Login sehen, wie die Recherche läuft, und angeben, welcher Account gelöscht, welcher übertragen werden soll. Allerdings tauchen dabei mitunter Geheimnisse auf: Der Ehemann, der bei der Partnerbörse angemeldet war. Der Freund, der Kunde beim Online-Casino war. Das Kind, das Bitcoins besaß, die digitale Währung, die man in Online-Spielen, aber auch im Darknet, wo Drogen und Waffen gehandelt werden, bevorzugt benutzt. Will man wirklich alles wissen? Versicherungsordner durchgehen ist eine Sache, aber im gesammelten Seelentohuwabohu herumstöbern eine andere. In Prä-Internetzeiten hätte man vielleicht ein Tagebuch gefunden, eines dieser kleinen Büchlein mit einem Schloss daran. Hätte man das Schloss geknackt und darin gelesen? Im Nachlass meines Vaters übernehmen meine Geschwister die Entrümpelung des greifbaren Lebens. Sie finden Briefe aus seiner Pubertät, alte Super-8- Filme und sein Abibuch. Die persönlichen Aufzeichnungen enden mit dem Hochzeitsvideo unserer Eltern. Sie stammen aus Zeiten, in denen es uns Kinder gar nicht gab. Wir lesen sie wie das literarische Werk eines Fremden.
Die Dokumente auf dem Rechner aber sind andere. Sie erzählen vom Leben, das wir geführt haben, von dem Menschen, der uns aufgezogen hat. Ich habe diesen Menschen geliebt, und ich will nicht, dass sich das ändert. Trotzdem fehlen uns noch immer Daten, Zugänge zu Online-Banking-Accounts, Kundennummern für Telefon und Strom. Ich klicke mich durch Ordner, versuche, das Ordnungsprinzip dahinter zu begreifen, frage mich, ob es überhaupt eines gab oder ob all diese Dateien nicht einfach ein großer Müllhaufen sind, ein Sammelsurium, wie diese eine Schublade, die es in jedem Haus gibt, in dem die Sachen landen, von denen man nicht weiß, wohin: Wunderkerzen, Pflaster, Kulis, Feuerzeuge, Murmeln.
Wer räumt schon regelmäßig seinen Rechner auf? Oder mehr noch: mistet ihn aus? Stattdessen kaufen wir neue, größere Festplatten und machen weiter. Drei Festplatten hatte mein Vater, ein Dutzend USB-Sticks, zwei Handys. Ich finde alte Rechnungen, Beschwerdebriefe wegen verspäteter Flüge, einige wenige Fotos. Auf einem davon sitzen meine Schwester und ich auf dem Schoß unseres Vaters, wir sind vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Er hat das Bild eingescannt, es stammt aus analogen Fototagen. Früher stand das Bild auf seinem Nachttisch, ungefähr in der gleichen Entfernung zu ihm wie später sein Rechner. Als ich es finde, muss ich heulen, klappe den Rechner zu und gebe auf.
Es gibt Menschen, die nennen sich Computerforensiker. Sie sezieren Festplatten, suchen nach Spuren und Hinweisen. Oft arbeiten sie mit der Polizei zusammen oder mit Banken. Sie durchforsten Rechner, weil sie herausfinden wollen, wer Passwörter gestohlen hat oder wie ein Fremder plötzlich Millionen von einem Konto abgehoben haben kann. Einige wenige allerdings arbeiten auch mit Bestattern zusammen. Armin Fimberger von der Firma „Digitales Erbe“ ist so einer, TÜV zertifizierter Datenschutzbeauftragter und IT-Forensiker. Bringt man einen Rechner zu ihm, baut er die Festplatte aus, liest die Daten aus und ordnet sie. Nach der Geräteanalyse bekommt der Kunde eine Aufstellung: 5673 Bilder gefunden, 34 Videos, 234 Musikdateien, diese und jene Software, 3 Avatare aus Computerspielen, 17 Accounts hier und da, so und so viele Bitcoins. „Wir können auch sagen, ob es eine weitere Festplatte geben müsste oder ob es ein Back up in einer Cloud gibt“, erklärt Fimberger. Er klärt mit dem Kunden, welche Daten behalten werden sollen, ob man die Bitcoins umtauschen möchte oder die Domains an der Domainbörse verkaufen möchte. „Zwei Dinge wollen alle“, sagt Fimberger, „Bilder und das Internet aufräumen.“ Niemand möchte durch Zufall online auf die Spuren eines Verstorbenen stoßen. „Bis jetzt hätten nur zehn bis zwölf Prozent der Verstorbenen über 65 Jahre ein digitales Erbe, das es zu verwalten gebe“, sagt er, aber das werde sich ab 2025 stark ändern.
Mein Vater gehört nun zu diesen zehn bis zwölf Prozent, und Fimberger kannte ich damals nicht. Verzweifelt habe ich deshalb einen meiner verrückten, nerdigen Freunde angerufen, der in einer Nachtschicht den Rechner durchsuchte. Am Morgen lagen auf der Schreibtischoberfläche fein säuberlich Ordner „Bank“, „Haus“, „Versicherungen“. Den Stromvertrag übernahmen wir. Die Autos meldeten wir um. Die Bankauszüge des vergangenen Jahres druckten wir aus und kündigten Mitgliedschaften im Tennisverein und bei der Aktion Mensch.
Sein Postfach beobachteten wir drei Monate lang, schrieben einer Handvoll Menschen, die wir nicht kannten, und lösten den Mailaccount auf. Nach einem halben Jahr war mein Vater auch aus der digitalen Welt verschwunden. Fast zumindest. Auch in einem Haus würde man ja nicht alle Bilder eines Menschen abhängen, weil er stirbt. Im Gegenteil, man hängt vielleicht noch ein paar mehr auf, um ihn nicht zu vergessen. Erinnerung digital sind für mich die Bilder, die es noch auf Facebook gibt, die andere von meinem Vater gemacht haben. Es ist sein MP3-Mix, der noch immer in seinem Auto läuft, wenn ich einsteige. Es ist das Startbild seines Navis, auf dem er mit meinem Sohn auf dem Schoß sitzt. Er lacht und ist glücklich dabei. Und genau so will ich ihn in Erinnerung behalten.
Autorin:
Pia Volk ist freie Journalistin und lebt in Leipzig. Über die Reisen mit ihrem Sohn hat sie ein Buch geschrieben: „Mama, sind wir bald da?“ ist im Herder Verlag erschienen.
Copyright: Dieser Text erschien erstmals in DAS MAGAZIN (November 2017) und wird an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung der Autorin veröffentlicht.